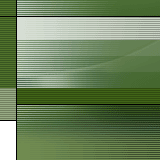

Hans Scholl
 Hans Scholl wurde am 22.9.1918 in Ingersheim bei Crailsheim geboren.
Hans Scholl wurde am 22.9.1918 in Ingersheim bei Crailsheim geboren.
Sein Vater, zunächst Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, dann Wirtschafts- und Steuerberater, war wie seine ganze Familie gegen den Nationalsozialismus eingestellt und musste wegen einer kritischen Bemerkung auch kurzzeitig in Haft.
Hans Scholl dagegen war am Anfang begeistert von dem Umschwung und der Hitlerjugend.
Er erlebte die Hitlerjugend als etwas Schönes. Man traf sich zum singen oder wandern oder ähnliches und man hielt zusammen wie zwischen freunden.
Doch nach und nach kamen Zweifel bei ihm auf, da die Führer der HJ in zum Beispiel keine ausländischen Lieder mehr singen lassen wollten. Auch wurden ihm Bücher weggenommen die nun verboten waren. Schließlich kam es zum rausschmiss.
Er war Fähnleinführer geworden und hatte mit seiner Gruppe eine flagge individuell gestaltet. Als ein höherer Führer einen aus seiner Gruppe aufforderte sie runterzuholen und die flagge zu hissen die alle haben und der Junge sich daraufhin weigerte, schlug Hans Scholl dem Führer ins Gesicht.
Bald darauf tat er sich mit anderen zur weißen Rose zusammen. 1937 wurde er bereits zum ersten Mal verhaftet. 1939 beginnt er sein Medizinstudium. In den Semesterferien musste er auch einmal an die Front in Frankreich und an die Ostfront.
Er starb von der Guillotine geköpft am 22.Feb.1943 (siehe Weiße Rose).
Anne Frank
Am 12. Juni 1929 wird Anne Frank als Tochter des jüdischen Kaufmanns Otto Frank und dessen jüdischer Frau Edith in Frankfurt am Main geboren.
Nach der Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933 emigriert ihr Vater nach Amsterdam. Dort wird er Direktor der holländischen Niederlassung der Firma Opekta.
Ein Jahr später folgt sein Frau ihm mit ihren Kindern Anne und Margot. Anne Frank besucht dort den Montessori- Kindergarten. 1935 kommt sie in die Schule.
Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die Niederlande am 10. Mai 1940 wird Anne Franks Leben mehr und mehr von antisemitischen Regeln und Gesetzen bestimmt.
1941 muss sie ihre Schule verlassen und auf ein jüdisches Lyzeum (Mädchenschule) gehen.
Am 14. Juni 1942 beginnt Anne Frank ihr Tagebuch in holländischer Sprache zu schreiben, durch das sie weltberühmt wurde. Nur kurze Zeit später muss sich die Familie verstecken, da die Deportationen begonnen hatten und eine Flucht aus den Niederlanden unmöglich war. Ihr Versteck befindet sich in der Prinsengracht 263 im Hinterhaus des väterlichen Geschäfts. Zusammen mit vier weiteren Personen werden sie dort von holländischen Angestellten des Geschäfts versorgt.
In ihrem Tagebuch beschreibt sie das Leben im Versteck und politische Ereignisse. Das Zusammenleben von acht Menschen und die entstehenden Konflikte finden ebenso Beachtung wie ihre eigenen Ängste und Bedenken.
Auch über die Deportation von 1.250 Kindern aus den Niederlanden in das Vernichtungslager Sobibor schreibt sie in ihrem Tagebuch. Im Sommer 1944 plant Anne Frank ihr Tagebuch nach dem Krieg unter dem Titel „Het Achterhuis" zu veröffentlichen und fertigt aus diesem Grund eine Reinschrift an.
Der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch findet sich am 1. August. Drei Tage später wird das Versteck verraten und alle Versteckten werden von der Sicherheitspolizei verhaftet und deportiert. Anne Franks Tagebuch wird später von den holländischen Angestellten gefunden. Sie selbst wird mit ihrer Schwester zunächst nach Westerbork und anschließend in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht.
Danach kommen sie zusammen in das Konzentrationslager Bergen- Belsen. Dort stirbt Anne Frank im März 1945 nur wenige Wochen vor der Befreiung an Typhus.
Zwei Jahre später veröffentlicht ihr Vater im Juni in Amsterdam das Tagebuch. Es wird in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt.
Zeitzeugenberichte :
Drei Berichte von Artur Führer (geb. 1929)"Plötzlich war ich ein Held"
„Im Kino und in der Wochenschau wurde uns immer wieder gesagt, wie toll wir Deutschen sind. Polen besiegt, Holland, Belgien, Frankreich. Als Schüler dachte man da natürlich: Wir sind auserwählt. Wir müssen diejenigen sein! Bei mir kam noch hinzu, ich war groß, blond, blaue Augen. Das war die nordische Rasse, die weltbestimmende Rasse, zumindest im Sinne der Nazipropaganda. Deshalb war ich auch vorgesehen für die Napola (Nationalpolitische Erziehungsanstalt/NS-Eliteschule d. Red.). Doch ich flehte meine Mutter an: Ja nicht unterschreiben! Bloß nicht! Ich wollte da nicht hin, weil ich gehört hatte, man muss dort boxen.
In der Schule haben uns Wehrmachtsoffiziere über den Krieg erzählt; auch SS-Offiziere. Die schilderten uns, was sie erlebt hatten. Manche trugen Abschusszeichen am Ärmel, wie viele Panzer sie vernichtet hatten. Die Lehrer an meiner Goethe-Oberschule in Gerstungen waren sehr nazitreu. Einer war in der SS; manche kamen in SA-Uniform zum Unterricht. Und Hitler war beinahe göttergleich. Diese Sprachgewalt und Überzeugungskraft: Wir werden ...! Ihr müsst ...! Das war ein Inbegriff von Stärke, und das hat sich übertragen. Hitler war unantastbar. Unantastbar! Es war ganz einfach. Wer nicht dafür ist, ist dagegen. Wer gegen Hitler ist, der ist ein Volksfeind. Gegen Kriegsende hieß es dann: Durchhalten bis die Wunderwaffen kommen! Wir haben das bis zum Schluss geglaubt.
Wir Hitlerjungen sind oft durchs Dorf marschiert, Fahne voran. Und ich hab eine Zeit die Trommel geschlagen, bis ich mal den falschen Schlag reingehauen habe. Am Wochenende waren große Wochenappelle, wo auch die Bevölkerung dabei sein konnte. Da gab es Ansprachen - im Grunde immer das Gleiche. Das hatte Methode, wurde uns richtig eingeimpft. Aber es wurden auch Pfingstlager organisiert, wir machten Schnitzeljagd und viele Wettkämpfe; Handgranaten- und Speerwurf. Es wurde ja immer wieder gefordert, nur der Beste kann bestehen. Und jeder wollte der Beste sein. Da ich sehr sportlich war, stieg ich bald zum Jungenschaftsführer auf. Wir Jungs wollten hart sein wie Kruppstahl. Jeder im Dorf wollte am längsten kurze Hosen tragen, bis in den Winter.
Wenn jemand zweifelte, hieß es: Pass auf, sonst geht es ins Konzertlager. Wir wussten, dass KZ was Schlimmes war. Was dort genau passierte, wollte keiner wissen.
Am 27. September 1944 nahm ich dann einen abgeschossenen US-Bomberpiloten gefangen. Hands up! Now you are prisoner of war!, schrie ich den an und hatte selbst mächtige Angst. Ich baute mich mit meinem HJ-Dolch vor dem Ami auf und bewachte ihn, bis sie ihn abholten. Mehr hab ich nicht gemacht. Der konnte auch gar nicht mehr richtig laufen, hatte einen Beinbruch von der Notlandung. Der tat mir sogar ein wenig Leid. Dafür wurde ich dann zum Oberjungenschaftsführer befördert und bekam ein Buch überreicht mit Appell und Trommelwirbel: 'Unbesiegt im Kampf'. Ich wurde dann auch noch nach Eisenach eingeladen zur Beförderung. Die ganze Prominenz der NSDAP war dabei. Ich wurde richtig als Held gefeiert, als großes Vorbild.
Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen."
„Die Schwarzen haben Messer im Mund!"
„Zu Hitlers letztem Aufgebot gehören Tausende so genannter Kriegsfreiwilliger. Das sind 15-jährige Burschen, die man im Schnellverfahren ausbildet und mit einer Panzerfaust in den Kampf schickt.
Am 12. Oktober 1944 bekam ich meine Einberufung. Ich paukte gerade Lateinvokabeln, als die Nachricht kam. Ich freute mich, war voller Enthusiasmus. Das war für mich eine Ehre. Ich wollte mich bewähren. Die Ausbildung in Kaltensundheim war dann ein Schock für mich. Das war menschenverachtender Drill. Wir wurden nachts rausgeholt. Es war ja November und kalt, wir hatten keine Wintersachen. Zum Beispiel mussten wir in Hockstellung einen schweren Schemel vor uns mit gestrecktem Arm halten und laufen. Wenn wir müde wurden, hat der Offizier geschrien: Du Schlappschwanz! Der hat uns so einen Dolch hinters Gesäß gehalten. Wenn man müde wurde, saß man mit dem Hintern auf dem Dolch.
Wir wurden an der Panzerfaust und im Nahkampf ausgebildet. Wir fragten uns natürlich: Wofür Nahkampf? Da wurde gesagt: Ja, wenn die Amerikaner komme... Da wussten wir, es geht an die Westfront, nicht gegen die Russen. Uns wurde Angst gemacht: Die Amerikaner schicken die Schwarzen vor, hieß es. Die haben ein Messer im Mund. Das wurde uns tagtäglich eingetrichtert. Wir mussten mit dem Karabiner, mit aufgepflanztem Bajonett, in lebensgroße Puppen stechen, immer in den Körper. Das war mir so zuwider. Nach sechs Wochen Ausbildung wurde gefragt: Wer von euch ist kriegsfreiwillig? Uns konnten sie ja nicht einfach an die Front schicken, wir waren zu jung. Da habe ich zum ersten Mal gezögert. Aber eigentlich mussten wir unterschreiben. Dann bekamen wir jeder eine rote Kordel, das Zeichen für Kriegsfreiwillige. Als ich nach Gerstungen zurückkam, haben uns die Lehrer als Vorbilder dargestellt und die Mädchen waren stolz.
Am 13. März 1945 war es soweit, um 7.00 Uhr abends kam der Ortsdiener zu uns nach Hause: Stellungsbefehl! In zwei Stunden Abmarsch. Meine Mutter umarmt mich, hielt mich fest. Sie sagte: Junge, du bist doch noch so jung! Da darf ich gar nicht dran denken. Sie wollte mich nicht loslassen. Mein Vater sagte dann: Komm Katrin, lass den Jungen. Der muss doch wissen, was ist. Und ich sagte: Ich muss! Mehr nicht.
Wir sind nach Mühlhausen in die General-Fuchs-Kaserne gekommen. Da wurden wir wieder zwei Tage rangenommen, Ausbildung. Anschließend haben wir eine richtige Kampfuniform bekommen, mit Stahlhelm. Ich erinnere mich noch an jede Sekunde, wie das ablief. Am Nachmittag wurden wir auf einem öffentlichen Platz vereidigt. Es war SS da, Wehrmachtsoffiziere, evangelische und katholische Pfarrer. Wir sprachen den Fahneneid, damit waren wir offiziell Soldaten, und man hätte uns als Kriegsgefangene anerkannt. Ohne Eid wären wir Partisanen gewesen, hat man uns erklärt. Dann wurden wir ins Kino geschickt. Wir sahen so einen Durchhaltefilm über Bergsteiger. Der Film hieß 'Wetterleuchten um St. Barbara'. Am nächsten Tag ging es an die Front."
"Die Kettenhunde wollten uns hängen"
„Gleich am Tag nach unserer Vereidigung wurde die ganze Truppe abends in Lkw‘s verladen. Mit kompletter Ausrüstung ging es an die Front, Richtung Westen. Aber keiner wusste genau wohin. Die Stimmung war schon gespannt. Dann stimmte jemand ein Lied an: In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehen. Das war unser Lieblingslied. Wir haben uns selber Mut gemacht. Wir wollten ja nicht sterben. Keiner wollte sterben, das kann keiner erzählen.
Es war der 14. März 1945. Wir waren alle irgendwie aufgekratzt. Ich knall‘ auch einen ab. Ich bring‘ auch einen zum Stehen, sagten wir uns. Wir wollten so ein Panzerabschusszeichen am Ärmel haben. Da war man fixiert drauf, auf diese äußerlichen Auszeichnungen. Wir gruben uns schnell ein. Dann ging die Hölle los. Es wurde geschossen und geschrien. Gleich in den ersten Gefechten fielen zwei, drei, die ich kannte. Einige wurden verletzt. Man wusste nicht mehr, was los war. Manche beteten. Die Amis schossen, wir feuerten. Das war ein Töten und getötet werden. Wir jubelten nur einmal, als wir einen Panzer trafen. Ketten weg, die Luke ging auf, es qualmte, der Ami stieg raus. Rechts von uns stand ein MG-Schütze und legte den um. Wir haben geschrien: Der tut uns nix mehr! Das war einmal aus Freude geschrien - alles andere war ganz schlimm.
Einige Stunden später war plötzlich Ruhe. Dann fragten wir uns: Wo ist denn unser Kommandant? Der Zugführer war auch weg. Die hatten sich verzogen. Da waren wir uns schnell einig: Wir wollen auch leben. Einer sagte, ich will 16 werden! Wir sind zu fünft abgehauen. Waffe und Stahlhelm schmissen wir weg. Doch dann schnappten uns die Kettenhunde und sperrten uns in eine Scheune. Wir waren Hochverräter - darauf steht Todesstrafe.
Todesurteil für Deserteure hieß Hängen am Baum. So war das üblich. Anfangs haben wir nicht richtig dran geglaubt. Wir dachten, die wollen uns nur einschüchtern. Doch als einer der Kettenhunde meinte: Hängen ist für die doch viel zu schade. Wir stecken das Ding in Brand. Da wurden wir hellhörig und wussten, die meinen es ja doch ernst. Fliehen ging nicht, die Scheune war verriegelt. Also klopften wir an die Tür, und als der Bewacher reinschaute, sind wir mit aller Wucht auf ihn drauf und haben ihn niedergeschlagen. Aber die Wache entdeckte uns; die haben dann auch eine drauf gekriegt. Dann hauten wir ab.
Wir mussten vorsichtig sein, diese Kettenhunde waren überall. Die suchten in Zügen, in Scheunen oder wo man sich sonst verstecken konnte. Das waren die aller brutalsten. Die haben ja genug aufgeknüpft. Es war klar, wir müssen uns trennen und einzeln durchschlagen. Im Luther-Gymnasium in Eisenach wollten wir uns später treffen. Ich besorgte mir Zivilkleidung in einem Haus, an dem die weiße Fahne hing. Bei denen hatte man nichts zu befürchten. Ostersamstag war ich wieder zu Hause. Einen Tag später kamen die Amerikaner. Da waren viele Schwarze dabei, doch keiner hatte ein Messer quer im Mund."
Auszüge aus einem Bericht
von der Journalistin Carola Stern über ihre Zeit als BDM- Führerin
„ Ich glaubte einer Gemeinschaft junger Idealisten anzugehören. Wir glaubten alle an den Führer, wir trugen alle die gleiche Uniform und wir sangen alle die gleichen Lieder. Ich habe bis heute ein unbewältigtes Verhältnis zu diesen Liedern. Manchmal frage ich mich, wer eigentlich einen größeren Eindruck auf uns gemacht hat, Adolf Hitler oder Hans Baumann, und ich bin fast geneigt, von Hans Baumann zu sprechen. Wissen Sie, es lagen in all diesen Liedern Sonnenblumen und Heldentod nahe beieinander. Es war das Unbestimmte, es war diese Gefühlsseligkeit in diesen Liedern. Ich erinnere mich an eins: „Deutschland, heiliges Wort". Mit dieser Gefühlsseligkeit wurde - so widersprüchlich das klingen mag – die Voraussetzung für das geschaffen, was dann später dabei herauskam: Härte, Mitleidlosigkeit, Unempfindlichkeit von 16- und 17-jährigen Menschen
Ein Bericht von Gerhard Krone (geb. 1934)"Wir waren eine begeisterte Jugend"
„Mit zehn wollte ich zu den Pimpfen, zum Jungvolk. Mutter besorgte dann auf Bezugsschein in Erfurt meine Uniform: braunes Hemd, eine kurze Cord-Hose und Schuhe; die waren an der Seite so geschnürt. Dazu gab es ein Koppel, Schulterriemen, schwarzes Halstuch mit braunem Knoten. Und siehe da: der Pimpf war fertig. Ab ging's zum Dienst, mittwochs und sonnabends. Wir marschierten und machten Geländespiele. Das hieß dann: Fähnlein 21 spielt gegen Fähnlein 19 und versucht den Wimpel zu erobern. Oft mussten die Fähnleinführer dazwischen gehen, damit wir uns nicht allzu sehr vermöbeln. Schön war auch, dass wir z.B. das Zelten lernten. Zeltbahnen knüpfen, Gras ausstechen für den Standort. Wenn das Zelt wieder abgebaut wurde, haben wir diese Grasstücken wieder so gesetzt, dass man nichts gesehen hat. Da haben wir sehr ernst genommen.
Wir Pimpfe sahen zu den großen Jungen von der Hitlerjugend auf, und die Soldaten waren unsere Helden. Als Kind hörte man ja in den Wochenschauen lange nur von den deutschen Erfolgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man konnte nur stolz sein auf diese Soldaten und wollte auch so eine Uniform tragen. Es gab damals so ein geflügeltes Wort: Bald bin ich groß und nicht mehr klein und werde Soldat des Führers sein. Wie stolz sind wir gewesen, als auf unserer Schule in Erfurt auf dem Dach ein Flakgeschütz montiert wurde. Wir waren überzeugt, dass der Krieg in irgendeiner Form zum Endsieg führen muss.
Die Zeugnisausgabe war immer sehr feierlich. Dann wurde die Flagge gehisst. Wir traten an mit Schulranzen, den rechten Arm zum Gruß ausgestreckt. Wenn wir müde wurden, legten wir den Arm auf den Schulranzen beim Vordermann. Zum Schluss sangen wir immer gemeinsam das Horst-Wessel-Lied.
Ich erinnere mich noch an einen tragischen Moment, das war Weihnachten 1944. Neben mir bekam ein Junge eine große Burg mit Soldaten geschenkt, also ein riesiges Spielzeug. Ich bekam nur eine Kleinigkeit. Da hab ich zu meiner Mutter gesagt: Guck mal hier, was der Junge neben mir gekriegt hat! Sie flüsterte mir dann ins Ohr: Der hat seinen Vater verloren. Kinder, wo der Vater gefallen ist, bekommen etwas Größeres. Da sagte ich mir, dann lieber nichts zu Weihnachten.
Ich freue mich heute noch über einfache Dinge, schätze auch die einfache Scheibe Brot. Wir mussten schon als Kinder sehr selbstständig sein."
Ein Bericht von Hans Fiedler (geb. 1937)"Ich wollte auch bei den Pimpfen dabei sein"
„Die NS-Propaganda hat schon gut funktioniert. Luftschutzmaßnahmen und der Krieg waren für uns völlige Normalität. Ich wohnte in der Löbnitzstraße 7, am Neumarkt, dem heutigen August-Bebel-Platz. Dort fanden die großen Appelle von SA, HJ, BDM und Jungvolk statt. Das waren heroische Veranstaltungen, muss ich sagen. Da waren alle mit Begeisterung dabei. So habe ich das als Kind empfunden. Wir wurden als Kinder ja so erzogen. Und als ich 1943 in die Schule kam - der Gruß 'Heil Hitler!' war gang und gebe. An ein 'Guten Morgen', 'Guten Tag' waren wir überhaupt nicht gewöhnt. Das war unbekannt. Grundsätzlich, wenn ich ins Geschäft ging und Milch gekauft habe oder Brot, da wurde richtig zackig der Arm hochgerissen und 'Heil Hitler' gerufen, und dann wurde auch so zurückgedankt mit 'Heil Hitler!' Das war das ganz normale Leben, was ablief. Und man hat auch nichts anderes, von keinem anderen erlebt.
Ich hatte auch den Wunsch, beim Jungvolk und bei den Pimpfen eines Tages dabei zu sein und mitzuwirken, nicht nur am Rande Zuschauer zu sein. Das war eigentlich schon jedem in die Wiege gelegt. Die Nazis machten für die Kinder tolle Spiele, bezogen sie aktiv ein. Wer erkennt das als Kind schon? Man wurde langsam daran gewöhnt. Auch als mein Vater und mein Onkel 1941 eingezogen wurden, haben wir das als Pflicht gegenüber dem Vaterland gesehen. Alle waren euphorisch, wir waren siegesgewiss. Jeder ging davon aus, dass alle heil blieben. Es gab natürlich Sorgen, dass die Angehörigen gesund von der Front zurückkommen, aber am Führer wurde nicht gezweifelt. Die Aktivitäten waren auch dementsprechend organisiert. Es gab das Winterhilfswerk, die Frauen strickten Strümpfe für die Soldaten an der Ostfront. Man hatte verschiedenste Möglichkeiten, sich zu engagieren.
1943 sah ich erstmals KZ-Häftlinge. Später erfuhr ich dann, dass die aus dem KZ Mittelbau-Dora waren. Das war ein ganz starker Eindruck auf mich. Wir gingen Richtung Güterbahnhof, und da kam uns eine Kolonne kahl geschorener, mit Holzpantinen bestückter Häftlinge entgegen, von Soldaten mit Karabinern bewacht. In Kompaniestärke zogen die an uns vorbei. Das war so ein bedrückender Eindruck. Solche Menschen hatte ich noch gar nicht gesehen - kahl geschoren. Aber da wusste auch keiner, wo die hingebracht wurden. Das waren eben irgendwelche Verbrecher und Straftäter. Die waren halt gefangen. Das hat auch, denke ich, in unserer näheren Umgebung keiner gewusst, dass dieses KZ Mittelbau-Dora existierte. Sonst hätte ja darüber mal einer gesprochen.
Ich möchte eigentlich nur, dass niemand mehr so etwas erleben muss. Gerade auch wegen der jüngsten Erfolge rechter Parteien. Das muss man der Jugend erklären."
Zwei Berichte von Hildegard Gebauer (geb. 1930)"Wir erkannten die Bomber am Klang"
„Wir konnten unterscheiden, ob es bloß Aufklärungsflugzeuge waren oder Bomber. Das hörten wir am Motorengeräusch. Wir hatten Angst; aus dem Radio war ja bekannt, dass Bremen, Hamburg, Kassel und andere westdeutsche Städte schon bombardiert wurden. Die Wohnungen wurden nachts immer verdunkelt. Dabei hatten wir bloß 25-Watt-Birnen. Wenn wir ins Bett gingen, legten wir unsere Sachen so hin, dass wir sie schnell wieder anziehen konnten. Das musste wirklich alles im Finstern klappen; sonst steht man da, halb verschlafen, findet nichts und muss runter in den kalten Keller. Mutti hatte immer genug mit dem Baby zu tun.
Jeder von uns Kindern nahm ein Paket mit in den Keller. Nichts Persönliches, sondern was für die Familie wichtig war. Bei sieben Personen kommt da Einiges zusammen. Die Mutti hatte so eine Tasche, da waren ihre Papiere und wichtigen Dokumente drin.
Wenn Entwarnung war und wir Glück hatten, konnten wir danach noch einmal ins Bett. Wenn wir Pech hatten, ging es ans Waschen, Anziehen, Frühstücken und in die Schule.
Manchmal heulten auf dem Schulweg die Sirenen. Dann rannten wir, so schnell es ging. Dabei versuchten wir, an den Häusern entlang zu schleichen, um nicht von oben sichtbar zu sein. Nach dem Fliegeralarm suchten die Jungs immer Granatsplitter. In den Jungmädelstunden haben wir Müffchen für die Frontsoldaten gestrickt. Bei diesen Treffen ging es um verschiedene Themen, die hatten teils gar nichts mit dem Krieg zu tun. Wir haben auch Sport gemacht, aber da war ich eine Niete. In den Schulferien züchteten wir im Klassenzimmer Seidenraupen für Fallschirmseide.
Sonntags hat meine Mutter immer Wunschkonzert im Radio eingeschaltet. Das war schöne Musik und da grüßten die Angehörigen die Soldaten im Feld oder umgekehrt. Abends um halb acht kamen Nachrichten. Die durften wir Großen auch hören, also mein Bruder und ich. Die anderen mussten ins Bett. Im Kino gab es die Wochenschau. Da wurden immer die ganzen Kriegsereignisse, also wen sie wieder alles vernichtet haben und wie viel Bruttoregistertonnen versenkt worden sind etc. gezeigt. Als dann die ersten Flüchtlingstrecks zu sehen waren, das ging schon unter die Haut.
Am 4. Dezember 1943 habe ich den schlimmen Bombenangriff auf Leipzig gesehen. Das war morgens gegen vier Uhr. Es war eine kalte Nacht. Als der Alarm zu Ende war, sind wir aus dem Keller hoch. Da war der Himmel über der ganzen Stadt dunkelrot, wie ein Feuerball. In der Lindenallee lagen verbrannte und verkohlte Leichen auf der Straße. Erwachsene Menschen, die nicht größer als ein Puppe waren, so waren sie zusammengeschmolzen. Es war schrecklich. Das vergesse ich nie. Auch unsere Schule wurde getroffen und Silvester sind wir Kinder dann ins Erzgebirge verschickt worden.
Uns ist die Kindheit und Jugend genommen worden. Ich musste von frühester Kindheit an Verantwortung tragen. Da habe ich schon auch einiges verpasst.""Am Anfang war bloß Hass und Angst"
„Beim schweren Bombenangriff auf Leipzig Ende 1943 wurde unsere Schule, die 23. Volksschule in Mockau, zerstört. Wir vier größeren Geschwister wurden dann Anfang 1944 ins Erzgebirge evakuiert. Meine Schwester Inge und ich kamen nach Affalter in eine Jugendherberge, meine Brüder nach Lößnig in eine Privatunterkunft. Die Kleinen blieben bei Mutter. Wir sind früh mit dem Zug nach Chemnitz und dann nach Zwönitz weiter. Von dort wurden wir mit einem Pferdeschlitten abgeholt. Das war schon ein Erlebnis. Wir sind dann oft Ski und Schlitten gefahren. Das haben die Nazis gut organisiert. Trotzdem ich hatte oft einen Albtraum in dieser Zeit: Unser Haus brannte. Das war so beklemmend und ich war froh, dann irgendwo anders zu sein und nicht in dem Flammeninferno. Dieser Traum ist dann ja auch Wirklichkeit geworden. Wir wurden am 27. Februar 1945 ausgebombt.
Weihnachten '44 kamen wir heim. Aber das Fest war sehr kläglich, weil es nichts mehr gab. Mutti hat zwar ihr Bestes versucht, aber die Stimmung war schon sehr gedrückt. Und überall waren Flüchtlingstrecks.
Unser Klassenlehrer aus Leipzig, Herr Schleif, betreute uns auch in der Kinderlandverschickung. Er war ein fantastischer Pädagoge. Was wir alles gemacht haben: Theater gespielt, Chorgesang, Wandern und natürlich Unterricht. Der hat uns beschäftigt, das hat die Trennung von der Familie schon erleichtert. Man hatte natürlich trotzdem Heimweh und machte sich Sorgen. Viele weinten abends im Bett, und trösteten uns dann gegenseitig. Wir Kinder waren alle durch die Kriegseinflüsse psychisch und körperlich angeknackst. Einer mehr, der andere weniger.
Als plötzlich der Krieg aus war, wusste man anfangs gar nicht, was das nun bedeutet. Ich musste eines Tages nach Affalter und traf den Schuldirektor, einen älteren Herrn mit Spitzbart. Heil Hitler!, grüßte ich wie immer. Da hat der mich komisch angeguckt. Kurz darauf wurde uns dann erklärt, wir sollen das nicht mehr sagen. Dass Deutschland den Krieg verloren hat, obwohl es immer hieß, wir siegen, mussten wir erstmal verdauen. Da hat sich keiner drum gekümmert, wie wir das verkraften. Eigentlich sollten wir so schnell wie möglich wieder nach Hause, aber das hat noch bis Mitte Juni gedauert. Das ist eine lange Zeit für ein Kind.
Wir verließen Affalter in offenen Lkws. Bei strömendem Regen fuhren wir bis Gießen bei Zwickau; über 300 Kinder. Und wir hatten Angst vor den Russen und Amerikanern. Wir dachten ja: Der Russe kommt aus der Taiga. Der sitzt auf dem Ofen. Das war unsere primitive Vorstellung. Und die Amerikaner, das waren für uns Neger mit Messer im Mund. In Gießen kamen jedoch keine Busse für den Weitertransport. Wir übernachteten beim Bauern in der Scheune. Es hat dann sechs Tage gedauert, bis es weiterging, wieder im Holzgaser nach Leipzig.
In Leipzig, in der Georg-Schumann-Straße, sah ich dann schwarze GIs. Meine Mutter war immer ängstlich und warnte mich: Mädel, pass bloß auf! Du bist blond und die schwarzen Neger. Wir hatten wirklich Bammel. Und über die Russen kursierten wilde Gerüchte: Die bleiben 50 Jahre - das schien unvorstellbar. Es hieß, dass die sich im Klobecken waschen. Da kam dann noch die Phantasie dazu. Das Bild war jedenfalls nicht schön, was wir von den Russen hatten. Am Anfang war da bloß Angst. Hass und Angst."
Ein Bericht von Regina Schädel (geb. 1929)"Ich konnte die Jungmädelei nicht leiden"
„Meine Freundinnen waren Scharführerinnen oder sonst was; ich habe die Jungmädelei nicht leiden können. Meine Familie war christlich geprägt. Da mit weißer Bluse und den Knöpfen am Blusenbund und dem drangehängten Rock - so waren die Jungmädel, weil sie noch keine Taille hatten und keine Gürtel - durch Gera marschieren und dieses Militärische, das war nicht mein Ding. Ich habe da sehr schnell die Kurve gekratzt und bin in die Singschar gegangen. Da waren BDM-Mädel drin und Jungmädel. Wir waren so eine Truppe außerhalb des üblichen Dienstplanes, weil wir ja üben und proben mussten. Weihnachten sangen wir im Krankenhaus oder auch zu politischen Anlässen, aber ansonsten lebten wir abseits.
Die NS-Propaganda in der Schule war schlimm. Das ging morgens los mit nationalsozialistischen Liedern und dem Hitler-Gruß. Jemand meldete: Wir singen das Lied 'Bomben auf Engelland', oder ein anderes. Das wurde uns eingetrichtert. Da musste jeder durch.
Meine Schwester hatte 1942 geheiratet und 1943 kam mein Schwager auf Urlaub - 14 Tage. Danach ging es zurück an die Front, er schaffte es gerade noch rechtzeitig in den Kessel von Stalingrad. Danach galt er als vermisst. Meine Schwester mit 20 Jahren, die wusste nicht, was mit ihrem Mann los ist. Nichts! Da haben wir die Feindsender abgehört. 'Bum, bum, bum' - den Londoner Sender. Da wurden Namen von Überlebenden aufgezählt. Eines Tages erfuhren wir dann von anonym, dass der Name meines Schwagers mit genannt worden war: als Überlebender in Gefangenschaft geraten. Auch mein Mann galt lange als verschollen. Beide kamen im Dezember 1949 zurück nach Hause.
Der erste große Bomberangriff auf Gera im Frühjahr 1943 hat uns gleich erwischt. Am Anfang war es hochinteressant, die Bomberverbände über uns fliegen zu sehen mit den Kondensstreifen. Das war ja etwas ganz neues und modernes. Wir standen auf dem Hof, alle Leute und Kinder aus dem Haus, und guckten nach oben. Auf einmal ein Zischen und Brausen, und da rief einer: Schnell in den Keller! Wir haben es nicht ganz geschafft, waren noch im Vorkeller. Da hat uns der Luftdruck einer Bombe niedergeschmettert. Alles voller Staub. Unsere Küche und das Waschhaus waren zerstört, die Wohnung verwüstet. Doch anfangs wurde Zerstörtes noch schnell repariert. Die offene Mauer wurde wieder zugemacht, man hat hinterher nichts mehr gesehen.
Bei einem Angriff ein paar Monate später traf es unsere Familie erneut. Meine Tante Marie ging nie in den Luftschutzkeller, weil sie Angst hatte, verschüttet zu werden. Das war überhaupt die größte Angst, unter den Trümmern zu liegen und nicht mehr raus zu kommen. Die Tante suchte deshalb in einem Keller unter dem Kohleschuppen Deckung. Der war nicht gemauert, sondern nur aus Holz. Und ausgerechnet dieser Schuppen wurde von einer Bombe getroffen. Tante Marie war tot. Uns anderen im Haus passierte nichts. Ich war fassungslos, weil ein Mensch, den ich so gut kannte, plötzlich nicht mehr da war.
Es gibt nichts Schlimmeres als den Krieg. Und wenn man einen Krieg selbst miterlebt hat, dann weiß man das."